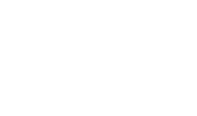Betriebsanweisungen und praktische Hinweise
8.1. Betriebsanweisungen
Die Anlagen und Geräte dürfen nur nach vorhergehender Einweisung und dem Studium dieser Betriebsanweisungen benutzt werden.
8.1.1. Umgang mit Chemikalien
Die Kenntnis der Betriebsanweisung für chemische und artverwandte Laboratorien der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Stand Juni 2002) wird bei allen am Praktikum teilnehmenden Studierenden vorausgesetzt.
Alle am Praktikum Teilnehmenden haben die Pflicht, sich vor der Beginn eines Versuchs über die Gefahren zu informieren, welche von den eingesetzten Chemikalien, Reaktionsgasen und den herzustellenden Produkten für die Gesundheit ausgehen und hieraus die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen für die Durchführung zu treffen. Grundlage hierfür ist die Kenntnis der Betriebsanweisungen für die jeweiligen Gefahrstoffe, welche die Hersteller i. A. zur Verfügung stellen, insbesondere die R- und S-Sätze.
Beim Umgang mit den Gefahrstoffen die dafür notwendige Schutzkleidung (Labormantel, Schutzbrille und eventuell Handschuhe und Gesichtsschutz) beim Umgang zu tragen.
Zur Minimierung jeglicher vermeidbarer Exposition sind alle Arbeiten mit Gefahrstoffen vorzugsweise im Abzug durchzuführen.
Als giftig gekennzeichnete Stoffe (T und T+) dürfen nicht in die Umgebungsluft exponiert werden. Liegt zusätzlich eine entsprechende Flüchtigkeit vor, müssen alle Manipulationen mit diesen Soffen im Abzug (Scheibe soweit wie möglich geschlossen)
oder in geschlossenen Apparaturen erfolgen.
Giftstoffe (T und T+) sind im Sicherheitsschrank zu lagern und dürfen nur kurzzeitig zur Stoffentnahme für die jeweiligen Präparate notwendigen Mengen daraus entfernt werden.
Da die meisten Präparate unter hohen Temperaturen synthetisiert werden, muss bei Gefahrstoffen besonders auf die Flüchtigkeit der eingesetzten Stoffe und eventuell sich bildender Produkte und Zwischenprodukte unter diesen Bedingungen geachtet werden (Siedepunkt und Dampfdruck).
Versuche mit giftigen und bei den Reaktionsbedingungen flüchtigen Stoffe dürfen nur in geschlossenen Apparaturen z. B. Quarzampullen, Rohröfen mit kontrollierter Zu- und Abluft oder in Öfen in Abzügen durchgeführt werden.
Bei Versuchen mit giftigen und bei den Reaktionsbedingungen flüchtigen Gefahrstoffen in Quarzampullen sind für den Fall eines Containerbruchs Maßnahmen zu treffen, welche eine Expositionsgefahr in die Umgebungsluft (Laborluft) minimieren. Werden Stoffmengen eingesetzt, welche eine beträchtliche Gefahr für die Gesundheit darstellen, so ist dafür die Benutzung eines Ofens im Abzug Pflicht.
Werden durch einen Containerbruch oder eine unvorhergesehenen Reaktion, Sublimationen etc. Gefahrstoffe in die Umgebung exponiert und Teile der Versuchsapparatur z B. die Ofenkammer kontaminiert, so sind die Assistenten umgehend darüber zu informieren. Die Gefahrstoffe müssen unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen mit größter Sorgfalt restlos entfernt und ordnungsgemäß entsorgt werden.
Reaktionen mit brennbaren, explosiven oder giftigen Gasen (z. B. Chlor) müssen während des gesamten Versuchs überwacht werden. Eine unbeaufsichtigte Durchführung in einem Nachtlabor mit CO2-Löschanlage erfolgt in Absprache mit den Assistenten.
8.1.2. Umgang mit Druckgasflaschen und Knallgasbrennern
Zum Abschmelzen der Ampullen wird ein Knallgasbrenner (H2/O2) benutzt. Es sind dabei folgende Sicherheitsanforderungen einzuhalten:
Die beiden Druckgasflaschen mit Wasserstoff und Sauerstoffgas sind in speziellen Gasflaschenschränken untergebracht und über eine feste Leitung zur Entnahmestation an der Abschmelzvorrichtung verbunden. Die Wasserstoffleitung ist zusätzlich mit einem Magnetventil gesichert. Das Öffnen der Flaschenhaupthähne, der Ventile an den Stationsdruckminderern sowie des Magnetventils darf nur von eingewiesenem Personal vorgenommen werden (i. A. die Saalassistenten oder die studentischen Hilfskräfte). Der Brenner ist über die beiden Schläuche mit der Entnahmestation über Klemmringverschraubungen fest verbunden.
Die Entnahmestation für jede Gassorte besteht aus einem Absperrventil, einem Druckminderer und einem Reduzierventil (Nadelventil). Vor dem Öffnen des Absperrventils an den Entnahmestationen ist zu prüfen, ob das Reduzierventil geschlossen sowie der Druckminderer auf Minimum eingestellt ist (Manometer beachten). Zur Betätigung der Ventile dürfen keine Werkzeuge verwendet werden!!!
Man überprüft, ob die beiden Ventile am Brenner geschlossen sind. Nach dem vorsichtigen Öffnen der Absperrventile an der Entnahmestation sind mit den Druckminderern für H2 bzw. O2 Vordrücke von jeweils max. 3 bar einzustellen. Anschließend werden die Reduzierventile an der Entnahmestation vorsichtig geöffnet.
Zum Zünden des Brenners wird dieser in den Abzug gehalten. Dieser darf keine brennbaren Materialien enthalten!!!! Dann wird zunächst das rote Wasserstoffventil am Brenner leicht geöffnet, bis ein deutliches Zischen vernehmbar ist. Mit einem Gasanzünder wird die Flamme nach kurzer Ausströmzeit gezündet. Anschließend wird das blaue Sauerstoffventil am Brenner vorsichtig geöffnet bis eine bläulich leuchtende, schwach zischende Flamme entsteht.
Vorsicht: Wasserstoff nicht zu lange ausströmen lassen, da sonst ein Knallgasgemisch entstehen kann.
Nach Gebrauch sind die Ventile für beide Gase in folgender Reihenfolge zu schließen:
1. Brennerventile
2. Reduzierventile an der Entnahmestation
3. Absperrventile an der Entnahmestation
Man entlastet die Brennerschläuche durch erneutes Öffnen und Schließen der beiden Brennerventile.
8.1.3. Abschmelzen von Quarzglasampullen:
Die, entsprechend der jeweiligen Arbeitsvorschriften im N2-Gegenstrom befüllten Ampullen werden am dafür vorgesehenen Pumpstand im Abzug in flüssigem N2 abgekühlt und evakuiert. Hierbei ist zu beachten, dass Ampullen, welche leicht flüchtige Stoffe, wie z. B. Brom, Jod oder wässrige bzw. nichtwässrige Lösungen enthalten, ausreichend abgekühlt sind, bevor Vakuum angelegt wird. Die Evakuierung derartig befüllter Ampullen darf nur bei angeschlossenen und mit N2 gekühlten Kühlfallen erfolgen!!!
Zum Abschmelzen muss eine dunkel getönte Schweißerbrille, Lederhandschuhe und ein Vollgesichtsschutz getragen werden. Es ist darauf zu achten, dass evtl. ZuschauerInnen in genügendem Abstand gehalten werden und ebenfalls Schweißerbrillen tragen, da sonst Augenschäden unvermeidlich sind.
Der Brenner wird leicht schräg nach oben gehalten, so dass die Flamme mit der Spitze des inneren Kegels die Abschmelzstelle berührt. Bei Aufleuchten des Glases wird der Brenner so um die verjüngte Stelle herumgeführt, dass ein gleichmäßiges Erweichen des Glases gewährleistet ist. Durch das angelegte Vakuum schließt sich die Ampulle an der verjüngten Stelle selbsttätig und kann mit der freien Hand (Handschuh!) abgezogen werden. Zu starkes punktuelles Erhitzen führt dazu, dass durch das anliegende Vakuum eine Blase nach innen gezogen wird, die zu einer Lochbildung in der Ampulle führt. In diesem Fall muss die Präparation von Anfang an wiederholt werden.
Durch unvorsichtiges Arbeiten und Nichteinhaltung der o. a. Vorschriften können Schädigungen an den Augen (z.B. Bindehautentzündungen, Verletzungen durch Splitter) und/oder Verbrennungen auftreten. Bei einem Unfall sind sofort geeignete Erste Hilfe-Maßnahmen zu ergreifen und die zuständigen Assistenten zu benachrichtigen.
8.1.4. Umgang mit evakuierten Quarzglasampullen
Aufgrund seines spröden Materialcharakters kann Quarzglas durch mechanischen Stoss leicht brechen. Aufgrund des Vakuums im Inneren und der daraus resultierenden Implosionsgefahr darf mit solchen Ampullen nur mit ausreichender Schutzausrüstung umgegangen werden (Schutzbrille, Labormantel und Lederhandschuhe).
Zum Transport sind Ampullen in geeignete Behälter aus Metall oder Kunststoff zu überführen.
Vor dem Einbringen von Quarzglasampullen in den Ofen ist eine Abschätzung des Innendrucks vorzunehmen. Der maximale Innendruck einer Ampulle darf 300 kPa (3 bar) nicht überschreiten, außer es liegt ein äußerer Kompensationsdruck an (Autoklav).
Das Aufheizen von Ampullen mit leicht flüchtigen Edukten (z. B. Halogene, Chalkogene) ohne äußeren Kompensationsdruck (Autoklav) darf nur sehr langsam erfolgen (max. 50°C/h), um einen zu starken Druckanstieg zu vermeiden.
Evakuierte Quarzglasampullen dürfen bis maximal 1050°C erhitzt werden. Bei sehr langen Reaktionen (> 14 Tage) sollten 950°C nicht überschritten werden, da die in diesem Temperaturbereich bereits einsetzende Kristallisation des Glases die Druckfestigkeit zunehmend beeinträchtigt.
Quarzglasampullen dürfen nicht in heiße Öfen eingebracht werden – Explosionsgefahr! Ebenso dürfen Ampullen nur aus vollständig abgekühlten Öfen entnommen werden.
Das Öffnen von Quarzglasampullen erfolgt nach vorsichtigem Anritzen mit einer Diamant- oder Widia-Klinge in einem ausreichend dicken Gewebe- oder Silkonschlauch im Abzug. Eventuell flüssige Produkte sind vor dem Öffnen in flüssigem Stickstoff einzufrieren.
8.1.5. Umgang mit Autoklaven
Das Beschicken der Autoklaven erfolgt nur nach vorheriger Einweisung durch die Assistenten.
Autoklaven sind Einzelanfertigungen. Die einzelnen Teile eines Stahlautoklaven (Zylinder, Verschlusskegel und Überwurfmutter) sind durch eingestanzte Nummern gekennzeichnet. Es dürfen nur die mit gleichen Ziffern gekennzeichneten Einzelteile zusammengefügt werden.
Stahlautoklaven unterliegen einer permanenten Korrosion. Man überzeugt sich vor der Benutzung eines Autoklaven auf die Rostfreiheit der Bohrung (Entfernung von Flugrost) und auf eine ausreichende Bodendicke.
Die konischen Dichtflächen an Zylinder und Verschlusskegel müssen glatt poliert sein. Unebenheiten oder Kratzer sind mit feinem Schmirgelpapier gründlich zu entfernen.
Um ein thermisches Verschweißen der Überwurfmutter mit dem Gewinde des Zylinders bei höheren Temperaturen zu vermeiden, werden diese mit MoS2-Spray (Molykott®) behandelt. Die konischen Dichtflächen an Verschlusskegel und Zylinder müssen jedoch frei von Schmiermittel bleiben!
Zur Erzeugung eines äußeren Drucks zwischen Ampulle und Autoklav wird der Zwischenraum mit zerstoßenem Trockeneis gefüllt und rasch verschlossen. Dazu muss der Autoklav bei der Befüllung unbedingt Raumtemperatur haben, da das Trockeneis ansonsten zu schnell wieder verdampft.
Sofort nach dem Verschließen muss eine sorgfältige Dichtigkeitsprüfung durchgeführt werden.
Die maximale Arbeitstemperatur für die im AFP verwendeten Autoklaven liegt bei 450°C.
Autoklaven dürfen nur in die dafür vorgesehenen abgekühlten Öfen eingebracht werden.
Das Öffnen der abgekühlten Autoklaven nach durchgeführter Reaktion erfolgt nur unter Aufsicht eines Assistenten in der vorgesehenen Vorrichtung. Der flexible Abluftschlauch ist möglichst nahe oberhalb des Autoklaven zu positionieren. Die Personen, welche die Öffnung des Autoklaven vornehmen haben einen Gesichtsvollschutz zu tragen. Andere anwesende Personen werden aufgefordert, sich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.
Autoklaven sind nach der Benutzung sofort gründlich zu reinigen und werden zur Verhinderung von Korrosion in einem Trockenschrank bei ca. 60°C gelagert. Autoklaven, welche durch Chemikalien kontaminiert sind (z. B. geplatzte Ampulle), müssen umgehend gründlich gereinigt und getrocknet werden.
8.1.6. Verwendung von Tiegeln
Im Rahmen des Praktikums kommen Tiegel und Schiffchen aus Porzellan, Sinterkorund (Al2O3), Nickel oder Platin zum Einsatz. Es dürfen nur die in den Versuchsvorschriften angegeben Tiegelmaterialien benutzt werden, da ansonsten eine ungewollte Reaktion der Edukte mit der Tiegeloberfläche oder eine Korrosion der Tiegel in der Ofenatmosphäre auftreten kann.
Bei Reaktionen, welche unter Bildung einer flüssigen Phase während der Temperaturbe-handlung im Ofen ablaufen, muss das unbeabsichtige Auslaufen der Schmelzen auf den Ofenboden durch Verwendung von passenden Schutztiegeln oder Einlegetabletts sichergestellt werden.
Proben in Tiegeln, welche aus heißen Öfen (>200° C) zum Abschrecken entnommen werden, dürfen nur auf spezielle thermoschockstabile Keramikplatten abgestellt werden, keinesfalls direkt auf die Labortische.
Verschmutze Tiegel sind nach der Benutzung unter Rücksprache mit den Assistenten zu reinigen. Hierfür ist die Korrosionstabilität der Tiegel zu beachten. Für Porzellan- und Korundtiegel können je nach Verunreinigung konzentrierte Säuren oder Basen sowie alkalische und saure Aufschlussverfahren angewandt werden (àJander/Blasius). Tiegel, deren Reinigung nicht möglich ist oder deren Reinigung einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeuten würde, sind entsprechend zu kennzeichnen, damit diese für das entsprechende Präparat weiterverwendet werden können.
Platintiegel
Platin als Werkstoff ist wesentlich empfindlicher – besonders bei hohen Temperaturen – als sein edler Charakter vermuten lässt.
Platin geht mit einer Reihe von Elementen Legierungen ein, deren Bildung zur Beschädigung bzw. Zerstörung der Platingeräte führt.
Zu diesen Stoffen in Elementarform zählen:
· Nichtmetalle: P, As, Si, B
· Metalle: Pb, Sn
Auch ihre Oxide reagieren leicht mit Platin!
In Gegenwart von Schwermetalloxiden, Kieselsäuren und Silikaten ist es besonders wichtig, reduzierende Bedingungen zu vermeiden.
Platintiegel werden nur gegen Unterschrift von den Assistenten ausgegeben und deren Verbleib in einem separaten Buch vermerkt. Bei Ausgabe und Rücknahme wird das Gewicht der Tiegel incl. Deckel im Buch vermerkt.
Platintiegel müssen äußerst vorsichtig gereinigt werden. Insbesondere mechanische Reinigungen sind strikt untersagt! In Rücksprache mit den Assistenten können je nach Verschmutzung heiße, max. halbkonzentrierte HNO3, NaOH und in begrenztem Umfang auch alkalische und saure Aufschlussverfahren genutzt werden (siehe Platin-Korrosions-Uhr[1]). Das gewählte Verfahren ist auf jeden Fall mit den zuständigen Assistenten abzusprechen. Keinesfalls dürfen bei Platin heiße konz. HNO3 oder gar Königswasser angewendet werden.
8.1.7. Umgang mit elektrisch betriebenen Öfen:
Im Rahmen des Anorganischen Fortgeschrittenenpraktikums kommen verschiedene Ofentypen zur Anwendung. Grundsätzlich unterscheidet man spezielle Bauarten wie Kammer-, Tiegel- oder Rohröfen. Die maximal erzielbare Temperatur eines Ofens ist abhängig vom Heizungstyp, den Isoliermaterialien und teilweise der Ofenatmosphäre. Im Allgemeinen wird für jeden Ofen vom Hersteller eine Maximaltemperatur angegeben, welche keinesfalls überschritten werden darf.
Die Benützung der Öfen erfolgt daher ausschließlich geregelt über einen passenden Temperatur- oder Programmregler.
Als Temperaturfühler dienen Thermoelemente, bei denen zwei Schenkel unterschiedlicher Metalle bzw. Legierungen an der Messstelle miteinander verschweißt sind. In Abhängigkeit von der Temperatur an der Messstelle entsteht an den kalten Enden der Schenkel eine Thermospannung, welche vom Messgerät bzw. vom Regler in eine Temperatur umgerechnet wird. Zum Schutz vor chemischen Reaktionen sind die Metalldrähte von einer Al2O3-Hülse oder einem flexiblen Inconel-Mantel umgeben. Im Praktikum kommen die unten genannten Typen zum Einsatz:
Bezeichnung | Typ | Messbereich | Thermospannung |
| Farbcode |
|
|
| [°C] | [mV]*) | Stecker + | Stecker - | Leitung |
Ni-CrNi | K | -270 – 1100 | -6,5 – 54,9 | rot | grün | grün |
Pt-RhPt (10% Rh) | S | -50 – 1600 | -0,2 – 16,8 | rot | gelb | weiß |
*) für Referenzstelle bei 0°C
In den verwendeten ofenunabhängigen Temperatur- bzw. Programmreglern sind die zu verwendenden Thermoelement-Typen voreingestellt, d. h. sie dürfen ausschließlich mit dem auf dem Regler gekennzeichneten Thermoelement-Typ verwendet werden. Bei falscher Kombination droht eine Überhitzung des Ofens mit entsprechender Gefahr eines Brandes und/ oder Beschädigung des Ofens.
· Die Benutzung der Öfen erfolgt nur in Absprache mit den Assistenten
· Bei ofenunabhängigen Reglern ist auf die richtige Auswahl des Thermoelement-Typs zu achten
· Die Übereinstimmung von programmierter und tatsächlicher Temperatur sind regelmäßig zu überwachen
Die im Praktikum verwendeten Öfen werden vorwiegend über eine elektrische Widerstandheizung beheizt. Keramische Isolationsmaterialen und metallischer Schutzleiter unterliegen je nach Temperaturen und Ofenatmosphäre einer beträchtlichen Korrosion. In manchen älteren Ofentypen wie den Klapprohröfen sind die Heizleiter zum Probenraum hin nicht isoliert eingebaut. Beim Hantieren mit Metallgegenständen wie Tiegelzangen an eingeschalteten Öfen besteht somit die unmittelbare Gefährdung durch Stromschläge.
· Metallteile am Ofen nur im ausgeschalteten Zustand anfassen.
· Ofen vor Einbringen der Proben bzw. vor der Entnahme der Proben ausschalten.
· Ofen grundsätzlich nur an Kunststoffgriffen und – schaltern anfassen.
Neben den beschriebenen Gefährdungen durch Fehlbedienung oder Stromschlag ist natürlich stets auf die Gefahr von Verbrennungen durch heiße Ofenteile oder heiße Proben zu achten.
· Probeneinbringung und -entnahme soll möglichst nur bei abgeschaltetem, abgekühltem Ofen erfolgen.
· Sollen Proben aus einem heißen Ofen abgeschreckt werden, muss auf entsprechende Schutzkleidung geachtet werden (z. B. Hitzehandschuhe, Tiegelzange)
· Heiße Proben werden zum Abkühlen auf spezielle Keramik- oder Glaskeramikplatten gestellt.
8.1.8. Umgang mit hydraulischen Pressen und Presswerkzeug:
Presswerkzeuge zur Herstellung von Tabletten sind präzise gearbeitete und oberflächenvergütete Metallwerkzeuge, welche während des Pressvorgangs hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt werden. Damit es während des Pressvorgangs nicht zu irreversiblen Schäden am Werkzeug kommt, ist ein sorgfältiger Umgang unumgänglich:
o Das Werkzeug muss vor der Befüllung frei von Schmutz und anhaftendem Pulver sein. Auf leichte Gängigkeit des Ober- und Unterstempels ist zu achten.
o Auf richtiges Zusammensetzen des Werkzeugs achten: polierte Seiten
der Stempel zur Probe hin, die abgeschrägte Kante des Ober- bzw. Druckstempels zeigt stets nach oben von der Probe weg!
o Die zu verpressenden Pulver dürfen nicht zu grobkörnig sein, da ansonsten zur Gefahr einer irreversiblen Riefenbildung in der Matrize kommt. Ebenso ist von der Verwendung unkonditionierter Nanopulver abzusehen, die leicht zwischen Stempel und Matrize gelangen können.
o Das Presswerkzeug darf nicht überfüllt werden: der Pressstempel muss mindestens 10 mm tief in die Bohrung eintauchen, um ein Verkanten während des Pressvorgangs zu vermeiden.
o Presswerkzeug und Presse sind so aufeinander abzustimmen, dass die Last zentral und gleichmäßig auf den Pressstempel aufgebracht werden kann, um ein Verkanten zu vermeiden.
o Die maximale Last für ein Presswerkzeug darf nicht überschritten werden (siehe Tabelle unten)! Bei der Verwendung metallischen Pulvern dürfen nur maximal 50 % der maximalen Last aufgegeben werden.
Presswerk- | max. Press-kraft [kN] | max. Last [kg/cm2] | max. Last [t] Specac-Presse |
10 | 50 | 100 | 5,0 |
13 | 100 | 200 | 10,0 |
o Für das Verpressen metallischer Pulvern ist ein gesondertes Presswerkzeug zu verwenden.
o Die Einzelteile eines Presswerkzeugs stellen ein genau aufeinander abgestimmtes Ensemble dar. Einzelteile zwischen den einzelnen Werkzeugsätzen dürfen nicht vertauscht werden.
o Alle Einzelteile müssen nach jedem Pressvorgang gründlich gereinigt werden. Zur Reinigung sind Bürsten, Spülmittel, Wasser, eventuell auch andere Lösungsmittel wie Ethanol oder Aceton zu verwenden
o Hartnäckige Verunreinigungen z. B. von Metallpulvern können vorsichtig mit einem Skalpellmesser abgeschabt werden. Die Anwendung abrasiver Reinigungsmethoden wie Scheuerpulver, Schmirgelpapier ist ausdrücklich verboten!
o Nach der Reinigung muss das Presswerkzeug mit Papiertüchern getrocknet werden (nicht im Trockenschrank!). In nassem Zustand entsteht an beschädigten Oberflächen leicht Flugrost!
o Ein feststeckendes Presswerkzeug darf nur von den Assistenten wieder gängig gemacht werden
Vorschrift zur Herstellung eines Pulverpresslings:
1. Vorbereitung und Pressvorgang:
1.1. Die Pressmatrize wird so auf die Basisplatte gestellt, dass die O-Ringdichtung des Fixierrings entsprechend einschnappt. Anschließend wird der Unterstempel eingelegt. Der Stempel muss gut in der Bohrung laufen und ohne großen Druck nach unten auf die Grundplatte sinken.
1.2. Man füllt das Pulver über einen Trichter ein, verdichtet durch leichtes Rütteln und führt den Oberstempel mit der polierten Seite nach unten unter leichten Drehbewegungen ein. Sofern ein zusätzlicher Druckstempel vorhanden ist, wird mit diesem der beidseitig polierte Oberstempel auf das Pulver aufgedrückt.[2]
1.3. Das Presswerkzeug wird auf die Basisplatte der Presse gestellt und der Druckstempel der Presse mit dem Handrad auf den Druck- bzw. Oberstempel des Presswerkzeugs bis zur Berührung herangeführt. Der Pressstempel sollte sich zentral über dem Presswerkzeug befinden.
1.4. Man schließt das Entspannungventil (rechts vom Hebel der Presse) und bringt durch mehrfaches Pumpen mit dem Hebel den Druck auf das Presswerkzeug auf (Manometer beobachten!). Die maximal für das jeweilige Presswerkzeug angegeben Last (s. o.) darf hierbei nicht überschritten werden.
1.5. Der gewünschte Druck wird mindestens 5 Minuten pro Pressling gehalten. Sinkt der Druck während der Zeit ab, wird durch erneutes Pumpen nachgestellt.
1.6. Man entspannt durch Öffnen des entsprechenden Ventils (Drehrad rechts am Hebel).
2. Auspressen:
2.1. Der Fixierring wird vorsichtig abgenommen und das Presswerkzeug mit dem Kopf nach unten auf die Basisplatte der Presse gelegt. Man legt einen Ausstoßring aus Kunststoff oder Metall zentral über die Pressmatrize und führt den Pressstempel der Presse über das obere Drehrad vorsichtig heran.
2.2. Nun wird durch leichtes Pumpen ein geringer Druck aufgebaut, durch den der jetzt oben liegende Unterstempel aus der Matrize herausgedrückt wird.
Man überprüfe, dass der sich herbei aufbauende geringe Druck am Manometer durch das Verschieben der Stempel sofort wieder entspannt. Ansonsten droht ein Festsetzen der Stempel bzw. eine Beschädigung des Ausstoßrings.
2.3. Der schließlich aus der Matrize geschobene Pressling (Vorsicht: sehr spröde!) wird vorsichtig auf einen flachen Spatel geschoben und in den vorbereiteten Tiegel bzw. das vorbereitete Schiffchen abgelegt.
2.4. Die anderen Stempel werden aus der Matrize entfernt und das gesamte Presswerkzeug gründlich gereinigt. Man überprüft nach Beendigung, ob die Leichtgängigkeit der Stempel in der Matrize gegeben ist.
8.2. Praktische Anweisungen
· Für Festkörperreaktionen, welche unter Luftausschluss in evakuierten Quarzglasampullen durchgeführt werden, sind die entsprechenden Betriebsanweisungen hierzu zu beachten (8.1.1 – 8.1.3).
· Bei Reaktionen, welche in offenen Tiegeln unter Zersetzung von Precursoren (z. B. Carbonaten oder Oxalaten) ablaufen, muss Vorsorge gegen ein Überschäumen oder Verspritzen der Probe im Ofenraum getroffen werden. Hierzu werden ausreichend große Tiegel verwendet und die Tiegel in Glühschalen gestellt. Die Aufheizrate sollte maximal 150°C/h betragen.
· Reaktionen in offenen Tiegeln, bei denen korrosive oder giftige Gase entstehen, dürfen ausschließlich in Öfen im Abzug durchgeführt werden.
· Für eine möglichst schnelle und vollständige Umsetzung müssen die Reaktanden bei Festkörperreaktionen möglichst fein und homogen miteinander verrieben werden.
· Zur Gewährleistung eines ausreichenden Kontakts der Körner werden bei Festkörperreaktionen ohne Beteiligung einer Gasphase die feingemörserten Edukte zu Tabletten verpresst.
· Für die Kontrolle des Reaktionsfortschritts, bzw. der Vollständigkeit der Reaktion werden von den Proben nach jeder Temperaturbehandlung Phasenanalysen anhand von Röntgenpulverdiffraktogrammen durchgeführt.
· Die Temperaturbehandlung der Proben ist unter erneutem Verreiben und Verpressen sooft zu wiederholen, bis eine vollständige Umsetzung erreicht ist.
· Man beachte die Betriebsanweisungen zum Umgang mit dem Knallgasbrenner, zum Umgang mit Quarzampullen und zum Abschmelzen derselben.
· Bei der Planung der Synthese muss für die auf den Versuchsanleitungen angegebenen Ansatzgrößen der zu erwartende Innendruck der Ampulle auf der Grundlage der idealen Gasgleichung bei der angegebenen Reaktionstemperatur berechnet werden. Dieser sollte maximal 300 kPa (3 bar) betragen. Formulieren Sie hierzu die Transportgleichung. Die Durchführung von Versuchen mit einem höheren Innendruck der Ampulle ist mit den Assistenten zu besprechen.
· Ampullen vor dem Befüllen immer im Vakuum gründlich ausheizen! Bereits Spuren von Wasser können die Reaktion gefährden und die Ampulle zum Explodieren bringen!
· Wird ein einfacher Einzonen-Rohrofen verwendet, muss vor Einbringen der Ampulle der Temperaturgradient im Rohr anhand eines Thermoelements vermessen werden.
· Ampullen dürfen nur in Rohröfen eingebracht werden, die sich auf Raumtemperatur befinden. Das Einlegen in heiße Öfen ist lebensgefährlich!
· Transportampullen mit berechneten Ampullendrücken > 1 bar (bei Tmax) dürfen nur sehr langsam aufgeheizt werden. (maximal 50°C/h).
· Nach Beendigung des Experiments wird der Ofen abgeschaltet.
· Nach dem Abkühlen der Ampulle im Ofen wird diese unter großer Vorsicht aus dem Ofen geschoben und optisch überprüft. Anschließend wird die Ampulle wieder in den Ofen gelegt und auf der Produktseite auf 300-500°C erhitzt (mindestens 200°C weniger als die Transporttemperatur). Nach Erreichen der Temperatur wird der Ofen gleich wieder abgeschaltet. Damit wird erreicht, dass abgeschiedenes Transportmittel vom Produkt absublimiert wird.
· Schmelzen können je nach chemischer Zusammensetzung eine hohe korrosive Wirkung auf Tiegelmaterialien haben (siehe „Aufschlussverfahren in der Analytik“). Entsprechend der Versuchsvorschrift muss ein geeignetes inertes Tiegelmaterial ausgesucht werden (Porzellan, Quarzglas, Korund, Graphit, Bornitrid, Nickel, Silber oder Platin).
· Bezüglich eines möglichen Auslaufens der Schmelze in den Ofen ist entsprechende Vorsorge zu treffen (Glühkasten als Auffangschale).
· Ist eine der Komponenten bei den angegebenen Reaktionsbedingungen leicht flüchtig, so ist die Umsetzung in einem der speziellen Tiegelöfen im Abzug durchzuführen. Es dürfen nur abgedeckte Tiegel verwendet werden.
· Schmelzen, welche schwermetallhaltige Komponenten enthalten, dürfen ausschließlich in Öfen im Abzug umgesetzt werden.
· Die von den Assistenten ausgegebenen Platintiegel sind pfleglich zu behandeln und müssen gut gereinigt zurückgegeben werden. Die Reinigung erfolgt erst nach Rücksprache mit den Assistenten! Für Schäden aufgrund unsachgemäßen Umgangs sind die BenutzerInnen verantwortlich!
· Man beachte die Betriebsanweisungen zum Umgang und zum Abschmelzen von Quarzampullen und zum Umgang mit Autoklaven.
· Da die Ampullen einem beachtlichen Aussendruck von bis zu 1000 bar ausgesetzt sind, müssen diese sehr sorgfältig abgeschmolzen werden.
· Durch Spannungen aufgrund von Dichteänderungen beim Auftauen eingefrorener Lösungen oder Suspensionen kann es zu Rissen in den Quarzglasampullen kommen. Die Gefahr wird deutlich reduziert, wenn Ampullen nach dem Abschmelzen sofort in ein Becherglas mit ausreichend warmem Wasser getaucht werden.
· Das Beschicken der Autoklaven erfolgt nur nach vorheriger Einweisung durch die Assistenten.
· Nach Ende der Reaktion müssen die Ampullen mit äußerster Vorsicht und geeigneten Schutzmaßnahmen gehandhabt werden (Leder-Schutzhandschuhe, Schutzbrille bzw. Gesichtsvollschutz).
· Ampullen, welche mit konzentrierter Jodwasserstoffsäure gefüllt sind, dürfen erst 24 h nach der Entnahme aus dem Autoklaven geöffnet werden. In dieser Zeit sind die Ampullen an einem sicheren Ort zu lagern (geschlossener Behälter).
· Vor dem Öffnen der Ampullen sind diese in flüssigem Stickstoff einzufrieren.
Bestätigung:
- Die vorstehenden Betriebsanleitungen wurden gelesen und verstanden.
- Ich habe die Laboratoriumsordnung gelesen und kenne die darin genannten Sicherheitsvorschriften.
- Vom Sicherheitsbeauftragten des Instituts bzw. seinem Stellvertreter wurde ich in die Sicherheitsvorkehrungen im Institutsgebäude und die sicherheitsrelevanten Einrichtungen des Praktikumssaales unterwiesen.
- Das Abschmelzen von Quarzampullen wurde praktisch geübt.
Freiburg, den _______________________
Gruppe 1: _______________________ __________________________
Gruppe 2: _______________________ __________________________
Gruppe 3: _______________________ __________________________
Gruppe 4: _______________________ __________________________
Gruppe 5: _______________________ __________________________
Gruppe 6: _______________________ __________________________
Gruppe 7: _______________________ __________________________
Gruppe 8: _______________________ __________________________
Gruppe 9: _______________________ __________________________
Gruppe 10: _______________________ __________________________
Gruppe 11: _______________________ __________________________
Gruppe 12: _______________________ __________________________
Gruppe 13: _______________________ __________________________
Gruppe 14: _______________________ __________________________
Gruppe 15: _______________________ __________________________
Gruppe 16: _______________________ __________________________
Gruppe 17: _______________________ __________________________
Gruppe 18: _______________________ __________________________
[1] http://www.ptlabware.com/technical_information/corrosion_clock/htm/uhr.htm
[2] Bei einigen Presswerkzeugen ist der Pressstempel identisch mit dem Oberstempel. In diesem Fall ist die nur dessen Unterseite poliert.